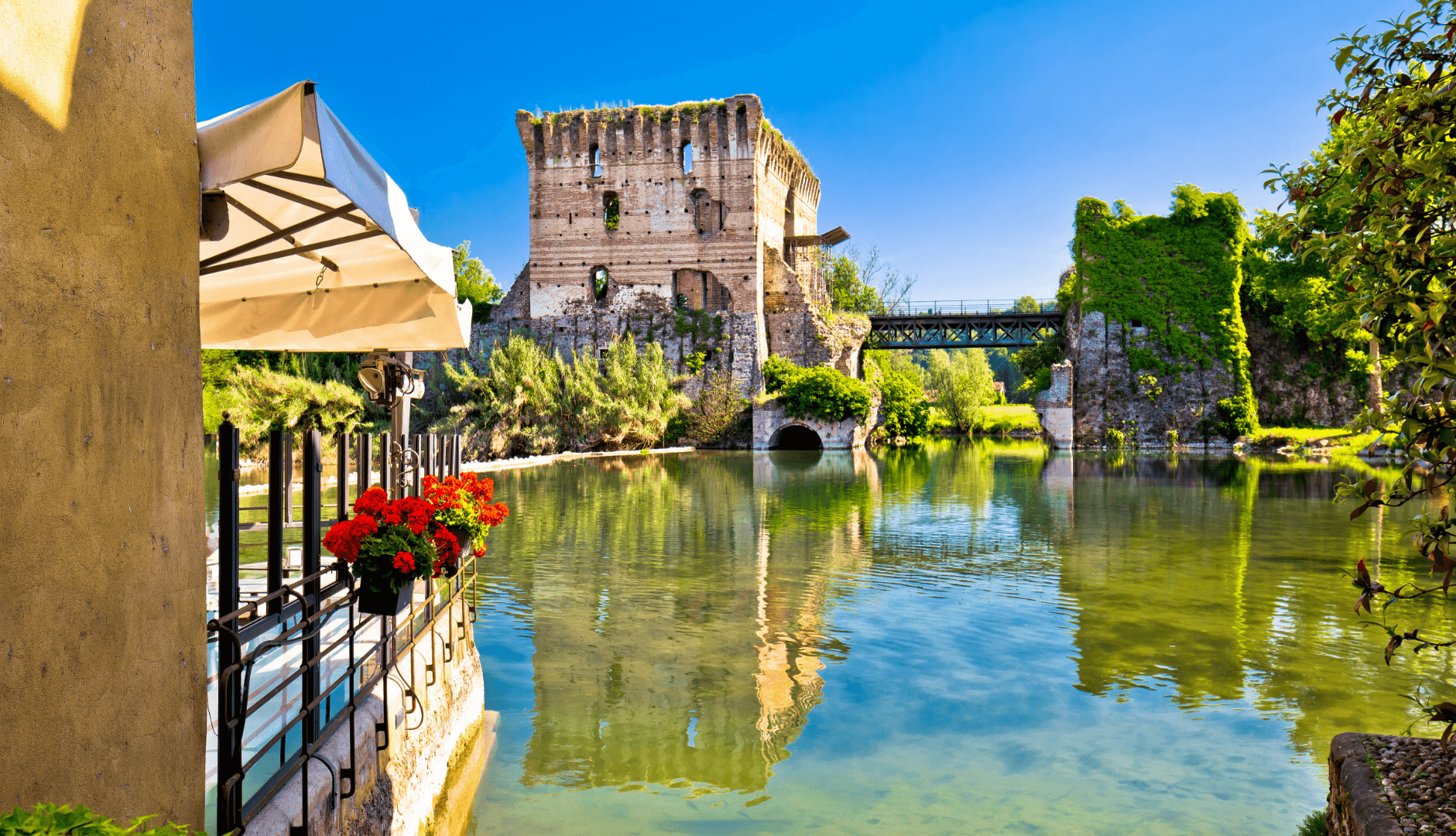
Franz Philipp von Fenner • Feldmarschallleutnant
Die Familie Fenner stammt aus Fennberg oberhalb von Margreid. Die älteste Kunde der Fenner finden wir im Urbar Meinhards II. von Tirol: Fenner-, später Widenhof zu Oberfennberg, 1288 Hof zum Venner. Der Adel der Familie Fenner von und zu Fennberg stammt aus dem Jahre 1667.
Franz Philipp von Fenner, geboren am 17. Juli 1759 in Unterfennberg, gestorben am 19. Oktober 1824 in Jaroslav, beigesetzt auf dem Bergisel (Innsbruck) am 15. Mai 1913, Feldmarschallleutnant und Ritter des Militär-Maria-Theresien-Ordens, Freiherr, verehelicht mit Maria Anna Josepha Gräfin von Wolkenstein-Rodenegg.
Er trat am 1. September 1777 als Kadett bei Lacy (Infanterie) ein, wurde 1778 Fähnrich, am 1. September 1786 Unterleutnant, am 1. Oktober 1788 Oberleutnant und nach beendetem Türkenkrieg 1790 Hauptmann im Scharfschützencorps. 1792 kämpfte er in den Niederlanden und wurde am 27. April 1793 Major. Bei Maindorf am Niederrehein am 31. Mai 1796 und dann wieder bei der Einnahme von Offenburg (26. Juni 1797) zeichnete er sich aus. Kurz zuvor (am 20. April 1797) wurde er Oberst. Als solcher stand er 1805 im Corps des Feldmarschallleutnant Jellacic und bewies beim Rückzuge aus Schwaben nach Vorarlberg große Umsicht.
Als Generalmajor tat er sich bei der Verteidigung Tirols 1809 und in den Kämpfen der Jahre 1813 und 1814 hervor. Am 16. Januar 1813 wurde er zum Feldmarschallleutnant ernannt. Er befehligte als solcher den rechten Flügel der Armee in Innerösterreich. Der 11. September 1813 bei der Mühlbacher Klause, der 3. Oktober bei Percha und der 7. Oktober wieder bei der Mühlbacher Klause waren seine Ehrentage. Bei letzterem Gefecht stellte sich Feldmarschallleutnant Fenner an die Spitze seiner Leute und erstürmte die Klause, wobei viele gegnerischen Soldaten getötet und sieben Offiziere und 450 Soldaten zu Gefangenen gemacht wurden. Für diese besonders kühne Waffentat erhielt er am 8. November 1814 da Ritterkreuz des Maria-Theresien-Ordens.
Schon vorher, am 16. Januar 1813, war er Inhaber des neu errichteten, nach ihm benannten Jägercorps geworden. Nach Beendigung des Krieges blieb er als Militärkommandant im Lande, wurde nach Auflösung des Tiroler Jägercorps 2. Inhaber des Kaiserjägerregiments, 1820 Divisionär in Mähren und 1821 in Galizien (heute Südpolen). Dort ist er dann auch im Alter von 65 Jahren gestorben.
Die Margreider Schützentracht
Im Laufe des Jahres 1982 wurde die Tracht angeschafft, deren Kosten größtenteils durch die Kompaniemitglieder selbst übernommen wurde. Für die Einkleidung der Kompanie haben auch das Kulturwerk für Südtirol und der Bezirk Bozen-Unterland einen ansehnlichen finanziellen Beitrag geleistet.
Die erste Ausrückung in der neuen Tracht erfolgte anlässlich der Gründungsfeier der Schützenkompanie Girlan am 11. Juli 1982.
Waffen

Der Säbel – zur Gruppe der Hieb– und Stichwaffen gehörend – ist eine seit dem 15. Jahrhundert in Europa gebräuchliche Blankwaffe. Ursprünglich wurde er als Hiebmesser bezeichnet, später setzte sich die aus Frankreich stammende Bezeichnung “Säbel” allgemein durch. Zunächst war der europäische Säbel vor allem eine Waffe des Bürgertums, die später auch vom Adel übernommen wurde. Als Vorläufer des europäischen Säbeltyps kann der vom Schwert abstammende Pallasch bezeichnet werden. Dieser weist – wie der Säbel – eine einschneidige Klinge auf. Pallasche wurden vorzugsweise bei der “Schweren Reiterei” verwendet. Die Vorläufer des heutigen europäischen Säbeltyps stammen aus dem Orient. Es sind dies der persische “Shamshir” (Löwenschweif) sowie der türkische “Kilij” (sprich Kilidsch). Was diese Säbeltypen gemeinsam haben ist ihre charakteristische gebogene Klinge. Die Griffstücke enden in einem stark nach vorne gebogenen Knauf.
Bei den Balkanvölkern setzte sich im Laufe der Zeit ein weiterer Säbeltyp durch. Es ist dies der “Handschar”, auch “Jatagan” genannt. Sein auffallender Griff hat dunkle Horn- oder Knochenschalen die sich am oberen Ende zu “Ohren” verbreitern. Seine Klingenführung weist eine leichte Wellenform auf. In der österreichischen Armee war er vor allem bei den serbischen Freikorps in Verwendung. Zunächst konnte sich der orientalische Säbel in unseren Breiten keine vorrangige Stellung unter den Blankwaffen erobern, da die schweren Reiter starke Plattenpanzerungen und widerstandsfähige Helme trugen. Anders verhielt es sich in jenen europäischen Ländern, die in kriegerische Auseinandersetzungen mit Völkern verwickelt waren, die schnelle Reitertruppen bevorzugten. Diesen, gleich einem Steppenwind angreifenden Völkern, musste eine gleichwertige Truppe mit gleichwertiger Bewaffnung entgegengestellt werden. Als exemplarisch für diese Entwicklung kann die Tatsache angeführt werden, dass die Ungarn aufgrund der türkischen Expansion den Säbel als allgemeine Bewaffnung für ihre Husarenregimenter einführten. Mit den Husaren begann der Siegeszug des Säbels in allen europäischen Armeen. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die österreichische Armee mit einem einheitlichen Säbeltyp bewaffnet. Auch die Offiziere trugen ab diesem Zeitpunkt anstatt des Degens nunmehr den Säbel. Die Weiterentwicklung des Säbels unterlag jedoch auch modischen Strömungen. So verflachte sich die Biegung der Klinge bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts soweit, dass man von einer beinahe geraden Klingenführung sprechen kann. Dies ist auch in ursächlichem Zusammenhang mit der Entwicklung des Säbels hin zu einer reinen Kommandowaffe zu bewerten, da durch die Einführung des Seitengewehres (Bajonettes) jeder Infanterist ohnehin mit einer effizienten Hieb- und Stichwaffe ausgestattet war.
Der Säbel der Schützen heute
Der nunmehr über den Südtiroler Schützenbund bezogene Säbeltyp (siehe Abbildung oben) ist der Offizierssäbel der österreichischen Infanterie, Modell 1861. Die Klinge ist leicht gekrümmt und auf beiden Seiten gekehlt. Sein Gefäß besteht aus dem mit Leder überzogenen Griffstück, der Griffkappe, dem Vernietknauf, dem Griffbügel, der Parierstange sowie dem Hinterarm der Parierstange mit zwei Schlitzen für den Faustriemen (Portepee). Die eiserne Scheide hat ein Ringband mit einer Trageöse sowie ein weiteres Ringband mit einem starren Tragering.
MAUSER K98 Gewehr
Ursprung: Deutschland, Spanien, Jugoslawien, Argentinien,
Unterscheidung: nur durch kleine Merkmale: Kammerstengel, Riemenhalterung am Schaft , Ausziehkralle und Auszieher.
Die Hauptbestandteile des Gewehrs sind : Lauf , Visiereinrichtung, Verschluss, Schaft, Handschutz, Beschlag.
Der Lauf: Äußerlich gebräunte Stahlrohre mit Mündung und Laufmundstück, oder Patronenlager (dort wird die Patrone zur Zündung gebracht)
Der Verschluss: verschließt den Lauf und bewirkt die Zuführung und Entzündung der Patrone das Ausziehen und Auswerfen der Patronenhülse nach dem Schuss. Teile: Hülse mit Schlosshalter Und Auswerfer, Schlossabzugseinrichtung und Kasten mit Mehrladeeinrichtung. Die Hülse nimmt das Schloss auf. In der Hülsenbrücke befindet sich oben die Führungsnute für die Führungsleiste der Kammer, links der Durchbruch für den Schlosshalter und den Auswerfer. Der Schlosshalter begrenzt mit dem Haltestollen die Rückwärtsbewegungen des Schlosses. Schlosshalter und Auswerfer sind durch die Schlosshaltschraube mit der Hülse beweglich verbunden und werden durch die Doppelfeder betätigt.
Das Schloss: Teile Kammer, Schlagbolzen, Schlagbolzenfeder, Schlösschen mit Druckbolzenfeder, Sicherung, Schlagbolzenmutter, Auszieher mit Auszieherring.
Schaft und Hautschutz: Der Schaft verbindet zusammen mit dem Beschlag und Handschutz sämtliche Gewehrteile zu einem Ganzen, ermöglicht die Handhabung des Gewehrs und schütz den Lauf. Schaft: Kolben, Kolbenhals, Handschutz. Der Kolben dient zum Einziehen des Gewehres in die Schulter. Der Handschutz liegt über dem hinteren Teil des Laufes.
Genauere Beschreibung des Laufes: Der Verschluss besteht wie schon erwähnt aus mehreren Teilen, angefangen mit der Kammer, der Schlagbolzenfeder, dem Schlagbolzen, der Sicherung, dem Schlösschen und der Schlagbolzenmutter, sowie der Kammer mit dem Kammerstängel auf die Kammer aufgesetzt und dem durch einen beweglichen Ring festgehaltenen Auszieher. Alle Teile sind Präzisionsteile und passen genau zusammen und sind daher sehr empfindlich. (z.B. Bruch des Ausziehers und des Kammerstengels etc.) Durch das Schließen des Schlosses wird die oberste Patrone aus der Mehrladeeinrichtung in das Patronenlager geschoben und gleichzeitig durch Zusammendrücken die Schlagbolzenfeder gespannt. Beim zurückziehen des Abzugstollen durch den Abzughebel wird die Schlagbolzenmutter frei, die Feder entspannt sich und schnellt den Schlagbolzen vor. Dieser trifft auf das Zündhütchen, drückt gegen den Amboss der Zündglocke und entzündet dadurch den Zündsatz. Die Stichflamme des Zündsatzes wird durch die Zündkanäle in den Pulverraum der Patronen geleitet und bringt das Pulver zum Verbrennen. Beim Verbrennen des Pulvers entstehen Gase mit dem Bestreben sich auszudehnen. Durch den Verschluss und das Patronenlager seitwärts, oben und unten gehindert, suchen sie den Weg des geringsten Wiederstandes – nach vorne. Durch das Verdichten in der Patrone erhöht sich der Druck im Verbrennungsraum. Dadurch entsteht beim Austritt der Gase aus dem Lauf ein scharfer Knall. Im Augenblick dieses Vorganges entsteht ein Gasdruck von 2600 kg.

Ehrensalve
Die Ehrensalve – die höchste Ehrerbietung
Das Gewehr des Schützen ist sicher keine Kampfwaffe mehr. Es ist ein Paradegewehr, ähnlich dem Ehrendegen in den alten Armeen, oder ähnlich der Hellebarde bei der Schweizer Garde oder den uralten Sakramentsgarden. Das Gewehr des Schützen ist für uns Symbol von Freiheit und Gerechtigkeit, die das Konzil und verschiedene Aussagen der Päpste als das Fundament des Friedens definieren. Es ist Symbol des Eintretens für die Würde des Menschen und die Grundwerte menschlichen Seins, ihres Schutzes und ihrer Wahrung.
Das Präsentieren des Gewehrs und das Abschießen einer Ehrensalve ist die schützengemäße Form eines Ehrenerweises, eines Grußes auch an den Herrgott, dem wir begegnen in der Botschaft des Evangeliums, in der Eucharistie und im Erweis seiner Gnade, seines Segens. Das Abschießen der Ehrensalve ist ein altes Friedenssymbol. Es heißt: “Für dich ist niemals eine Kugel im Lauf. Ich komme zu dir und will dir als Freund begegnen!”
Wir Schützen bekennen uns als Christen, verankert in unseren Grundsätzen “Treue zu Gott und der Kirche”. Wir Schützen bekennen uns zur Landesverteidigung “Schutz von Heimat und Vaterland”, wenn wir auch klar und deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir heute nicht mehr die Träger der Landesverteidigung sind. Und so stehen auch für uns Tiroler Schützen das Gewehr und die dazugehörigen Salve eben für Freiheit und Gerechtigkeit und – von alters her “” als Zeichen des Friedens.
Als am 18. April 2002 die Bayerischen Gebirgsschützen im Vatikan für Kardinal Joseph Ratzinger – dem heutigen Papst – eine Salve abfeuerten, bezeichnete letzterer diesen ausdrücklich als Explosion der Freude, und nicht als kriegerischen Akt. Und er freute sich vor allem darüber.
Wenn wir als Schützen ein Fest feiern gilt es für uns als Selbstverständlichkeit, den Gottesdienst in den Mittelpunkt zu stellen. Wir Schützen gehören zu einer Pfarrgemeinde und bekennen uns auch dazu als Christen, wo wir auch vielfach den Beweis erbringen, dass wir auch bereit sind, dort mitzuarbeiten.
Schießen einer Ehrensalve
Das Abfeuern einer Ehrensalve (General-de-Charge) ist die größte Ehrbezeugung, die Schützen (und Militärs) zu vergeben haben. Deshalb steht sie nach alten Regeln nur dem Herrgott, der Majestät des Todes und den Regierenden zu, d.h:
bei Feldmessen und Prozessionen: nach dem Evangelium
bei Begräbnissen (in Absprache mit den Angehörigen und der Geistlichkeit) und Totenehrung: vor der Kranzniederlegung
bei der Begrüßung des Bundespräsidenten, Bundeskanzlers, Bundesministers oder eines ausländischen Staatsgastes, des Landeshauptmannes, des Landtagspräsidenten oder eines Landesrates, der ausdrücklich den Landeshauptmann vertritt.
als fester Bestandteil des Tiroler Zapfenstreiches, des Großen Österreichischen Zapfenstreiches und zu den entsprechenden Ausbildungszwecken.
Fahne hissen
Das Hissen der Tiroler Landesfahne sollte uns zu gegebenen Anlässen eine Selbstverständlichkeit sein. Es soll dies sowohl als Zeichen der Freude zu festlichen Anlässen, aber auch als Zeichen des Bekenntnisses zu unserer Tiroler Heimat geschehen.
Im Jahreslauf sind es folgende Tage, an denen es alte Sitte ist, die Tiroler Fahne aufzuziehen:
- 20. Jänner – Sebastiani
- 20. Februar – Andreas-Hofer-Sterbetag
- 19. März – Josefi, Tiroler-Landesfeier
- Sonntag nach Ostern – Weißer Sonntag
- Sonntag nach Fronleichnam – Fronleichnam-Sonntag
- Herz-Jesu-Sonntag – Herz-Jesu-Feier
- 15. August – Mariä Himmelfahrt
- 11. November – Das Land Tirol in Trauer (Fahne mit Trauerflor)
- Kirchtag – Kirchtag im jeweiligen Dorf
In Gemeinden ist es üblich, etwa die Feier des Hl. Sebastian am darauf folgenden Sonntag zu begehen oder den Tag der Ersten Hl. Kommunion nicht am Weißen Sonntag, sondern an einem anderen Sonntag im Jahreskreis zu feiern. Selbstverständlich wird dann die Fahne am jeweiligen Festtag aufgezogen.
Das Hissen der Fahne erfolgt bei Sonnenaufgang. Bei Sonnenuntergang wird die Fahne wieder eingezogen. Fahnen – aus Bequemlichkeit – bereits am Vortage aufzuziehen, bzw. tagelang nicht einzuholen, ist nicht angebracht.
Die Farben der Tiroler Landesfahne sind Weiß-Rot. Wenn die Fahne an einer Saalwand oder auf einem Rednerpult angebracht wird, gilt die Faustregel: Die erstgenannte Farbe muss vom Publikum aus linker Hand zu sehen sein.
Unsere Schützenfahne
Vermutlich führten die alten Kompanien sowie die 1. Kompanie Margreid des Standschützenbaons Kaltern II eigene Fahnen, die jedoch leider bis heute, nicht zuletzt dank der faschistischen Unterdrückungspolitik, als verschollen gelten. Unsere Schützenfahne wurde mit der Wiedergründung 1982 dank unserer Fahnenpatin Gertraud Augustin angeschafft.
Die Kompaniefahne trägt einen grün-weiss-grün-weiss gestreiften Untergrund mit dem Hoheitswappen Tirols, dem roten Adler. Auf der anderen Seite trägt sie das Wappen der Gemeinde Margreid.
Nach 30 Jahren wurde unter Initiative unserer geschätzten Fahnenpatin Gertraud Augustin eine neue Fahne angeschafft, da die ersten 30 Jahre nicht spurlos vorübergegangen sind. Diese Fahne wurde im Jahr 2012 anlässlich unseres 30-jährigen Jubiläums geweiht!
Unser Kompaniewappen
Das Kompaniewappen ist schlicht gestaltet und trägt den Tiroler Adler und das Margreider Wappen. Das Margreider Wappen stellt ein Schild dar, welches zwei geteilt ist, oben in Rot gehalten und unten in Schwarz. Darin ein goldenes Posthorn ohne Verschnürrungen. Die Farben Rot und Schwarz entsprechen dem Wappen des alten in Margreid sesshaften und im Jahre 1511 ausgestorbenen Geschlechts “ob der Platten”. Das Posthorn scheint in Margreider Gemeindesiegel von 1780 auf. Weiters trägt unser Wappen den abgerundeten Schriftzug Schützenkompanie “Franz von Fenner” Margreid.
Schützenkompanie Wilten
Anlässlich der Gründungsfeier haben die Margreider Schützen die traditionsbewusste und angesehene Wiltener Schützenkompanie, unter Führung von Hauptmann Hofrat Franz Rosenkranz, als Ehrenkompanie eingeladen. Diese hat ihr Schützenheim in unmittelbarer Nähe des Bergisel und unterhält gute Beziehungen zum Kaiserjägerclub, der die Gedenkanlage auf dem Bergisel betreut, zu der auch die Kapelle gehört, in der Feldmarschallleutnant Franz von Fenner die letzte Ruhestätte gefunden hat. Aus diesem Grund, aber vor allem zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und der alten Landeseinheit Tirols haben die Margreider mit den Wiltenern Schützen eine Partnerschaft angestrebt, die in den folgenden Jahren durch die Knüpfung von Freundschaften vertieft werden konnte und seitdem immer wieder zu gegenseitigen Einladungen geführt hat und nun einen zentralen Punkt der Margreider Schützentätigkeit einnimmt.
Anläßlich des 30jährigen Jubiläums wurde von der Kompanie Wilten ein Partnerschaftstreffen in Innsbruck organisiert, an dem weitere Partnerkompanien der SK Wilten teilnahmen. In Margreid feierten wir dieses Jubiläum beim Törggelen im November 2013.
Statuten
Genehmigt auf der Ordentlichen Bundesversammlung am 27. April 2019 in Bozen und gemäß Beschluss der O. BV am selben Tag in Kraft getreten
§ 1
Der Verein trägt den Namen „Südtiroler Schützenbund EO“. Er umfasst das Gebiet des Südlichen Tirol und hat seinen Rechtssitz in Bozen. Er ist ein nicht anerkannter Verein.
§ 2
Zweck des Bundes und der ihm angeschlossenen Schützenkompanien sowie Schützenkapellen ist:
a) Die Treue zu Gott, Festhalten am christlichen Glauben – überlieferter Väterglaube – und am geistig- kulturellen Erbe der Vorfahren.
b) Der Schutz der Heimat, der Tiroler Lebens- und Wesensart und der heimatlichen Natur- und Kulturlandschaft.
c) Die Einheit des Landes Tirol, die beispielgebende Ausübung der Rechte und Pflichten der Südtiroler zur Erhaltung der Tiroler Wesensart und zur Existenzsicherung der deutschen und ladinischen Volksgruppe in der angestammten Heimat.
d) Die Freiheit und Würde des Menschen.
e) Die Pflege des Tiroler Schützenbrauchs, der heimatlichen Trachten und des Scheibenschießens.
Diese Grundsätze zu wahren ist oberste Verpflichtung der Tiroler Schützen.
Tätigkeiten des Bundes sind:
Der Bund verfolgt hauptsächlich und vorrangig Tätigkeiten von allgemeinem Interesse:
a) Maßnahmen zum Schutz und zur Aufwertung des kulturellen Erbes und der Landschaft gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 42 vom 22. Januar 2004 und nachfolgenden Änderungen;
b) Organisation und Ausübung von kulturellen, künstlerischen oder Freizeitaktivitäten von sozialem Interesse, einschließlich Verlagstätigkeiten zur Förderung und Verbreitung der Kultur und Praxis der ehrenamtlichen Tätigkeit und Tätigkeiten von allgemeinem Interesse gemäß diesem Artikel;
c) Der Bund kann weitere Tätigkeiten im Sinne des Art. 6 des GvD 117/2017, die sekundär und instrumentell zu der im allgemeinen Interesse ausgeübten Haupttätigkeit sind;
Der Bund verfolgt keine Gewinnabsichten und verfolgt bürgerschaftliche, solidarische und gemeinnützige Ziele.
§ 3
a) Als Mitglieder können nur in einer Tiroler Gemeinde gebildete Schützenkompanien bzw. Schützenkapellen aufgenommen werden, die sich vorbehaltlos zu den Grundsätzen des Bundes bekennen, eine Tiroler Tracht tragen und alle Bestimmungen dieses Statutes getreulich zu erfüllen versprechen. Die Aufnahme erfolgt über Antrag der Kompanie vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Bezirksversammlung durch Beschluss des Bundesausschusses. Der Bund kann auch Körperschaften des Dritten Sektors oder ohne Gewinnabsichten aufnehmen, die keine ehrenamtlichen Organisationen sind; in keinem Fall darf die Anzahl der aufgenommenen Körperschaften des Dritten Sektors oder ohne Gewinnabsichten mehr als 50% der Anzahl der ehrenamtlichen (Mitglieds-) Organisationen betragen. Die Entscheidung über die Aufnahme als Mitglied (bzw. auch über die Nichtaufnahme) wird dem Beitrittswerber bekannt gegeben. Falls die Aufnahme verweigert wird, muss die Entscheidung begründet werden. Die Aufnahme des neuen Mitglieds wird im Mitgliederregister vermerkt. Abgelehnte Beitrittswerber können innerhalb von 60 Tagen ab der erfolgten Ablehnung Rekurs an die Bundesversammlung stellen, die bei ihrer nächsten Versammlung endgültig über den Beitritt entscheidet.
b) Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich um das Tiroler Schützenwesen besondere Verdienste erworben haben. Die Ernennung zu Ehrenoffizieren setzt eine mindestens zehnjährige aktive Mitgliedschaft in der Alpenregion der Schützen voraus. Die Ernennung erfolgt über Antrag des Bundesausschusses durch Beschluss der Bundesversammlung.
Förderer:
Als Förderer können Personen gelten, welche dem Südtiroler Schützenbund jährlich einen von der Bundesleitung festgesetzten Förderbeitrag entrichten. Sie haben weder aktives noch passives Wahlrecht.
Ehrenamtliche Mitarbeiter:
Personen, die ehrenamtlich mitarbeiten, aber keine Mitglieder sind, werden in einem eigenen Verzeichnis geführt.
§ 4
Die Mitglieder und Ehrenmitglieder können nach den näheren Bestimmungen dieses Statutes die Tätigkeit des Bundes mitbestimmen. Sie sind weiters berechtigt, an allen Veranstaltungen des Bundes und seiner Zwischengliederungen teilzunehmen, die vom Bund geschaffenen Auszeichnungen zu tragen und sonstigen Begünstigungen in Anspruch zu nehmen.
Die Mitglieder sind verpflichtet, dieses Statut und die in seiner näheren Ausführung ergehenden Vorschriften genau einzuhalten, die Mitgliedsbeiträge pünktlich zu bezahlen und alles vorzusehen und zu fördern, was den Grundsätzen des Bundes entspricht.
Die Mitglieder haben das Recht die Vereinsbücher einzusehen. Dazu muss vorher eine schriftliche Anfrage an die Bundesleitung gestellt werden.
§ 5
Die Mitgliedschaft erlischt durch:
a) freiwilligen Austritt nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten. Der freiwillige Austritt wird vom Bundesausschuss entgegengenommen.
b) Ausschluss wegen grober Verletzung des Statuts. Der Ausschluss erfolgt über Antrag des Bundesausschusses durch die Bundesversammlung.
c) Anstelle des Ausschlusses kann das Mitglied bis zu einer Höchstdauer von drei Jahren suspendiert werden. Durch die Suspendierung ruhen die Rechte des Mitgliedes. Im Suspendierungsbeschluss können auch Rechte belassen bzw. Pflichten eingeschränkt werden. Die Suspendierung erfolgt durch den Bundesausschuss und ist von der nächsten Bundesversammlung zu bestätigen oder aufzuheben.
§ 6
Die Organe des Bundes sind:
a) die Bundesleitung
b) der Bundesausschuss
c) die Bundesversammlung
d) die Rechnungsprüfer (Kontrollorgan)
e) das Schiedsgericht
§ 7
Die Bundesleitung setzt sich zusammen aus:
a) dem Landeskommandanten
b) dem Landeskommandantstellvertreter
c) dem Landeskuraten (geistlicher Beistand)
d) dem Bundesgeschäftsführer
e) dem Bundeskassier
f) den Bezirksmajoren
g) den Referenten
Der Bundesleitung obliegt die oberste Leitung des Bundes nach den Beschlüssen des Bundesausschusses und der Bundesversammlung. In unaufschiebbaren Angelegenheiten kann die Bundesleitung auch anstelle des Bundesausschusses und der Bundesversammlung vorläufige Beschlüsse fassen, die vom zuständigen Organ bei der darauf folgenden Versammlung zu bestätigen oder aufzuheben sind.
Die Bundesleitung definiert Tätigkeiten, die laut § 2, Absatz 2, Bst. a) und b.) sowie weitere Tätigkeiten, die laut § 2, Absatz 2, Bst. c) festgesetzt sind.
Die Bundesleitung wird vom Landeskommandanten nach Bedarf, jedenfalls aber zur Vorberatung eines Bundesausschusses und der Bundesversammlung einberufen. Der Landeskommandant hat eine Sitzung der Bundesleitung einzuberufen, wenn es ein Drittel der Mitglieder der Bundesleitung oder 5 Bezirksmajore verlangen.
Die Bundesleitung ist bei Anwesenheit des Landeskommandanten oder seines Vertreters und der Hälfte der Mitglieder beschlussfähig und entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Die gewählten Bundesleitungsmitglieder ernennen die Referenten und bestätigen die Wahl der Bundesjungendreferenten, der Bundesmarketenderin und des Vertreters der Ladiner. Der Vertreter der Ladiner wird von den Kommandantschaften der ladinischen Kompanien in gemeinsamer Sitzung gewählt. Er muss Offizier und ladinischer Muttersprache sein.
Alle Mitglieder der Bundesleitung tragen den Dienstgrad eines Majors.
§ 8
Rechte und Pflichten der Mitglieder der Bundesleitung:
Der Landeskommandant vertritt den Bund nach innen und außen, leitet die Sitzungen der Bundesleitung, des Bundesausschusses und der Bundesversammlung und führt bei Bundesveranstaltungen das Kommando.
Der Landeskommandant wird im Verhinderungsfalle von seinem Stellvertreter und in dessen Verhinderungsfall in weiterer Folge von den übrigen Mitgliedern der Bundesleitung (ausgenommen dem Landeskuraten) nach der aufgezählten Reihenfolge vertreten.
Der Aufgabenbereich aller Mitglieder der Bundesleitung wird in der Funktionsbeschreibung der Mitglieder der Bundesleitung festgelegt.
§ 9
Mitglieder des Bundesausschusses sind:
a) die Mitglieder der Bundesleitung
b) die Bataillonskommandanten
c) die Delegierten, wobei jeder Schützenbezirk pro fünf Kompanien einen von ihnen gewählten Delegierten im Offiziersrang entsendet.
Dem Bundesausschuss obliegt die Beratung und Beschlussfassung in allen Bundesangelegenheiten, die nicht ausdrücklich der Bundesversammlung vorbehalten sind. Insbesondere hat der Bundesausschuss für die Wahl der Mitglieder der Bundesleitung und der Rechnungsprüfer sowie des Schiedsgerichtes einen Wahlvorschlag zu erstellen. Der Bundesausschuss kann Angelegenheiten zur Beschlussfassung an die Bundesleitung delegieren.
Der Bundesausschuss wird vom Landeskommandanten nach Bedarf, jedenfalls aber vor einer Bundesversammlung einberufen. Der Landeskommandant hat eine Sitzung des Bundesausschusses einzuberufen, wenn es die Bundesleitung oder ein Drittel der Mitglieder des Bundesausschusses verlangen. Der Bundesausschuss ist bei Anwesenheit des Landeskommandanten oder seines Stellvertreters und der Hälfte der Mitglieder beschlussfähig und entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
§ 10
Der Bundesausschuss kann Vorschriften zur einheitlichen Organisation und Führung des Schützenwesens erlassen. Solche Vorschriften sind insbesondere:
a) Grundsätze zur Bildung von Schützenbezirken, die von der Bundesversammlung genehmigt werden
b) Grundsätze zur Bildung von Bataillonen
c) Grundsätze zur Führung einer Schützenkompanie
d) die Schießordnung
e) die Exerziervorschrift
f) Richtlinien für Dienstgradabzeichen, Tragen von Orden und Ehrenzeichen
g) die Schiedsgerichtordnung
h) die Funktionsbeschreibung der Mitglieder der Bundesleitung
§ 11
Die Bundesversammlung setzt sich zusammen aus den Hauptmännern oder den bevollmächtigten Vertretern der Mitgliedskompanien- bzw. Kapellen.
Der Bundesversammlung obliegt:
a) die Wahl der Mitglieder der Bundesleitung, der zwei Rechnungsprüfer (gleichzeitig Kontrollorgan), der zwei Ersatzrechnungsprüfer und der Mitglieder des Schiedsgerichtes für jeweils drei Jahre nach den Bestimmungen des §12, und deren Abwahl;
b) die Genehmigung der Geschäftsordnung der Bundesversammlung;
c) die Genehmigung der Bilanz sowie der Geschäfts- und Rechenschaftsberichte und Entlastung der Amtsträger;
d) die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages;
e) die Beschlussfassung zur Verantwortung der Mitglieder der Vereinsorgane und Ausübung der Haftungsklage diesen gegenüber;
f) die Ernennung von Ehrenmitgliedern, Ausschluss und Suspendierung von Mitgliedern, Statutenänderungen und die Auflösung des Bundes;
g) die Beschlussfassung zu allen weiteren Fragen, die gemäß Art. 25 des GvD 117/2017 in die unveräußerliche Zuständigkeit der Bundesversammlung fallen.
Die Bundesversammlung wird vom Landeskommandanten einmal jährlich einberufen. Der Landeskommandant ist berechtigt, in dringenden Fällen eine außerordentliche Bundesversammlung einzuberufen und ist dazu verpflichtet, wenn es der Bundesausschuss oder ein Drittel der Mitglieder verlangen. Die Einberufung einer Bundesversammlung hat schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mindestens vierzehn Tage vor ihrem Zusammentreten zu erfolgen. In der Einladung ist darauf hinzuweisen, dass Anträge von Mitgliedern nur behandelt werden, wenn sie mindestens acht Tage vor Beginn der Bundesversammlung schriftlich dem Landeskommandanten zukommen.
Die Mitglieder des SSB (Schützenkompanien- und Kapellen) haben je ein Stimmrecht.
Die Bundesversammlung ist bei Anwesenheit des Landeskommandanten oder seines Vertreters und der Hälfte plus eines der Stimmrechte beschlussfähig und entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten, sofern es dieses Statut nicht anders bestimmt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Wenn die Beschlussfähigkeit der Bundesversammlung zur festgesetzten Stunde nicht gegeben ist, wird der Beginn eine halbe Stunde verschoben. Nach Ablauf dieser Zeit ist die Versammlung beschlussfähig. Diese Bestimmung gilt nicht für die Beschlussfassung über die Auflösung des Bundes.
§ 12
Die Wahl der Bundesleitung – ohne Landeskurat – erfolgt nach dem vom Bundesausschuss erfolgten Wahlvorschlag in geheimer Wahl. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der Anwesenden Wahlberechtigten erhält. Sollten für eine Funktion mehrere Kandidaten vorgeschlagen sein, und keiner der Kandidaten erhält die absolute Mehrheit, dann ist eine Stichwahl notwendig zwischen jenen zwei Kandidaten, die, die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten.
Wahlordnung der Bundesleitungsmitglieder:
Landeskommandant
Landeskommandantstellvertreter
Bundesgeschäftsführer
Bundeskassier
Der Bundesausschuss erstellt mindestens drei Monate vor der Wahl einen schriftlichen Wahlvorschlag, dieser wird allen Stimmberechtigten mindestens ein Monat vor der Wahl durch das Bundesbüro zugesandt. Durch die Stimmberechtigten eines Bezirkes können bei der Bezirksversammlung ein gesamter oder ein Teilvorschlag aus dem Bezirk erstellt werden. Dieser ist von mehr als der Hälfte der anwesenden Wahlberechtigten zu unterstützen. Der Wahlvorschlag muss mindestens acht Tage vor der Sitzung des Bundesausschusses schriftlich im Bundesbüro eingebracht werden. Von den zur Wahl vorgeschlagenen Schützenkameraden ist eine schriftliche Einverständniserklärung beizulegen.
Die Wahl der Bezirksmajore, ihrer Stellvertreter, der drei Beiräte und der Delegierten zum Bundesausschuss erfolgt in geheimer Wahl in der Bezirksversammlung mindestens 15 Tage vor der Bundesversammlung.
§ 13
Bei der Bundesversammlung können sich die stimmberechtigten Mitglieder durch einen mit schriftlicher Vollmacht ausgewiesenen Vertreter von derselben Kompanie vertreten lassen. Ein Bevollmächtigter darf jeweils nur ein stimmberechtigtes Mitglied vertreten.
Bei Sitzungen der Bundesleitung können sich die Bezirksmajore durch ihren Stellvertreter vertreten lassen.
§ 14
Alle Ämter und Funktionen der Bundesleitung und der Bezirksleitungen müssen freiwillig und ehrenamtlich ausgeübt werden, ebenso erbringen die Mitglieder ihre Leistungen ausschließlich ehrenamtlich. Den ehrenamtlichen Mitgliedern dürfen nur die für den Verein ausgelegten Spesen, ebenso wie die tatsächlich erwachsenen Kosten ersetzt werden, allerdings letztere nur in dem Ausmaß wie sie vom Bundesausschuss festgesetzt oder angenommen werden.
§ 15
Änderung des Statutes:
Die Bundesversammlung kann über Änderungen des Statutes nur dann gültige Beschlüsse fassen, wenn diese mindestens einen Monat vorher den Kompanien zur Kenntnis gebracht wurden und in der mit der Einberufung veröffentlichten Tagesordnung angeführt sind.
Änderungen des Statutes bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimmrechte.
§ 16
Bei allen Meinungsverschiedenheiten in Schützenangelegenheiten zwischen Kompanien, zwischen diesen und Offizieren des Bezirkes oder des Bundes oder zwischen Offizieren, findet die Disziplinarordnung Anwendung. Es kann, nach vorherigem Schlichtungsversuch durch die Bezirks- bzw. Bundesleitung das Schiedsgericht angerufen werden.
Dieses wird von der Bundesversammlung auf Vorschlag des Bundesausschusses gewählt. Es besteht aus drei effektiven und zwei Ersatzmitgliedern.
Die Bestimmungen über das Verfahren sind durch die Disziplinarordnung geregelt.
§ 17
Das Vermögen des Bundes besteht aus:
a) beweglichen oder unbeweglichen Gütern, die durch Ankauf, Schenkung oder jedwede andere Art rechtskräftigen Erwerbes in den Besitz des Bundes übergegangen sind;
b) den zu besonderen Rücklagen bestimmten Beträgen. Das Inventar des Bundes ist in einem Inventarbuch zu führen, das laufend zu ergänzen ist.
Jedwede Art des Vermögens, das eventuell von einem Bezirk erworben und dessen Verwaltung der Bezirksleitung übertragen ist, fällt bei eventueller Auflösung des Bezirks dem Südtiroler Schützenbund zu.
Während des Bestehens des Bundes dürfen keine Verwaltungsüberschüsse und Gewinne sowie Rücklagen, Reserven oder Kapitalanteile – auch nicht indirekt – verteilt werden. Die Finanzmittel des Bundes sowie etwaige Gewinne oder Verwaltungsüberschüsse müssen ausschließlich für die Realisierung der satzungsgemäßen Zwecke oder für damit direkt verbundene Ziele verwendet werden.
§ 18
Die Einnahmen des Bundes bestehen aus:
a) den Mitgliedsbeiträgen, die bis spätestens 01. März zu entrichten sind, widrigenfalls die Kompanie bei der ordentlichen Bundesversammlung kein Stimmrecht hat;
b) Einnahmen, die von Bundes- und Bezirksveranstaltungen herrühren;
c) Geld- oder Sachwerten, die aus Zuschüssen, Spenden, Schenkungen, Hinterlassenschaften usw. kommen oder sonst wie eingehen.
§ 19
Auflösung des Südtiroler Schützenbundes:
Die Bundesversammlung kann über die Auflösung des Bundes nur beschließen, wenn mindestens zwei Drittel der Stimmrechte anwesend sind. Der Beschluss über die Auflösung bedarf einer Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Stimmrechte.
§ 20
Wird der Bund aufgelöst, ist das Vermögen, welches nach Deckung aller Verbindlichkeiten verbleibt, gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, gemeinnützigen Zwecken zuzuwenden, und zwar den Einrichtungen, Vereinen, Organisationen usw., welche die Förderung des Wohles der deutschen und ladinischen Volksgruppe in Südtirol zum Ziele haben bzw. gleiche oder ähnliche Zielsetzungen wie der Südtiroler Schützenbund verfolgen und nachweislich dafür arbeiten.
Über den neuen Träger des Vermögens entscheidet die Bundesversammlung nach den Mehrheitsverhältnissen wie sie für § 19 gelten.
§ 21
Bei allen nicht in diesem Statut geregelten Bestimmungen gelten jene des Kodex des Dritten Sektors, des Zivilgesetzbuches und anderer einschlägigen Rechtsnormen.
